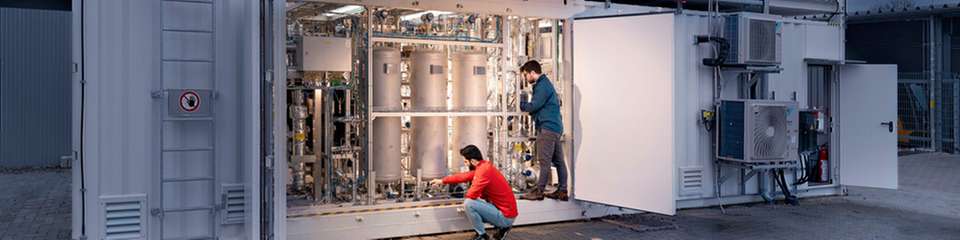Der Seeverkehr verursacht 14,2 Prozent aller verkehrsbedingten CO₂-Emissionen in der EU und liegt damit hinter dem Straßenverkehr und nahezu gleichauf mit der Luftfahrt. Das geht aus dem am Dienstag von der EU-Umweltagentur und der EU-Agentur für maritime Sicherheit (EMSA) veröffentlichten Umweltbericht für den europäischen Seeverkehr hervor. Die CO₂-Emissionen sind demnach seit 2015 mit Ausnahme von 2020 jährlich gestiegen und beliefen sich 2022 auf 137,5 Millionen Tonnen, 8,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Mindestens verdoppelt haben sich laut Bericht zwischen 2018 und 2023 die Emissionen des noch stärker als Kohlendioxid wirkenden Treibhausgases Methan (CH4) durch Seeschiffe. Sie machten 26 Prozent aller Methanemissionen des Verkehrs aus. Die Autoren führen das unter anderem auf den Einsatz von mehr mit Flüssigerdgas (LNG) angetriebenen Schiffen zurück.
Nabu: „LNG verhindert echte Transformation der Schifffahrt“
Als „erschreckend“ bezeichnet der Naturschutzbund (Nabu) die Entwicklung. Schließlich habe Methan kurzfristig eine vielfach höhere Klimawirkung als andere Gase. Dadurch steige die Gefahr, dass Kipppunkte im Klimasystem früher erreicht würden, mahnt Sönke Diesener, Schifffahrtsexperte bei der Umweltschutzorganisation, im Gespräch mit der DVZ. Der Nabu fordert schon seit Längerem, dass die EU und die Internationale Maritime Organisation (IMO) ihre Annahmen über den Methanausstoß von Schiffen korrigieren. Die EU geht von einem Methanschlupf von 3,1 Prozent aus, die IMO von 3,5 Prozent. Der Nabu hat bei Messungen festgestellt, dass bis zu 6 Prozent des Methans unverbrannt in die Atmosphäre gelangen. „LNG ist keine Brückentechnologie und verhindert eine echte Transformation der Schifffahrt Richtung Zukunft“, betont Diesener.
Die Carrier setzen derweil sehr stark auf LNG als alternativen Schiffsantrieb, wie Zahlen zu aktuell betriebenen und bestellten Schiffen des Klassifizierungsunternehmens DNV zeigen. Unter allen Antriebsarten, die als „alternativ“ deklariert sind, hat LNG den höchsten Anteil an der existierenden und künftigen Flotte (siehe nachfolgende Grafik). DNV zufolge setze sich die starke Nachfrage nach LNG auch in diesem Jahr fort. Im Januar wurden bereits zwölf Schiffe mit entsprechendem Flüssigerdgasantrieb bestellt.
Emissionskontrollzonen für Schwefeloxide wirken
Was die Luftschadstoffe angeht, haben die Emissionen von Stickoxiden (NOx) durch Seeschiffe von 2015 bis 2023 um 10 Prozent zugenommen, während die Emissionen von Schwefeloxiden (SOx) in der EU seit 2014 um 70 Prozent zurückgegangen sind. Ursache für diesen Rückgang sei vor allem die Einrichtung von Schwefeloxid-Kontrollzonen (SECAs) in Nordeuropa. Weitere Fortschritte erwarten die Autoren, wenn der Mittelmeerraum ab dem 1. Mai 2025 zur SECA wird. In dem Bericht geht es zudem um Umweltbelastungen durch Wasserverschmutzung, Lärm und Arbeiten wie Hafenerweiterungen oder Ausbaggerungen.
EU-Verkehrskommissar spricht von „Aufruf zum Handeln“
Die Branche mache Fortschritte auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, müsse aber in den kommenden Jahren ihre Anstrengungen „verdoppeln“, damit EU-Umwelt- und Klimaschutzziele erreicht werden könnten, kommentierte die EU-Kommission den Bericht. Dieser sei „auch ein Aufruf zum Handeln“, sagte EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas. „Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sicherstellen, dass der Seeverkehr ein wichtiger Akteur in unserer globalen Wirtschaft bleibt, während wir gleichzeitig seine Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und unsere Ozeane für zukünftige Generationen erhalten.“
Rahmenbedingungen für einen Übergang zu nachhaltigerer Schifffahrt will die EU unter anderem durch Vorschriften für zunehmend klimafreundlichere Schiffstreibstoffe (FuelEU Maritime) sowie durch die Ausweitung des Emissionshandels auf den Seeverkehr schaffen. FuelEU Maritime schreibt vor, dass seit dem 1. Januar 2025 die Treibhausgasintensität aller großen Schiffe erfasst und bis 2050 schrittweise immer stärker reduziert werden muss. Der Emissionshandel wird im Seeverkehr seit dem 1. Januar 2024 ebenfalls schrittweise eingeführt. Emissionsberechtigungen für Reisen auf von der Regelung betroffenen Routen müssen den Behörden erstmals Ende September vorgelegt werden.
Bisher wenige Schiffe mit alternativen Antrieben unterwegs
Die Zahl der mit alternativen Treibstoffen fahrenden Schiffe in der EU steigt laut dem Bericht, ist aber bislang überschaubar. Mit Methanol wurden 2024 demnach 33 Schiffe betrieben, 29 weitere seien bestellt. 3 Schiffe mit Wasserstoffantrieb seien in Betrieb, 5 weitere in Auftrag gegeben. In einer Zusammenfassung des Berichts werden allerdings keine Angaben gemacht, um welche Schiffstypen es sich dabei handelt. Gleiches gilt für die aufgelisteten Schiffe, die mit Windkraft, Biokraftstoffen oder anderen synthetischen Treibstoffen fahren. Mindestens 44 EU-Häfen hätten Verbindungen zur landseitigen Stromversorgung (Onshore Power Supply, OPS) eingerichtet, wobei 352 Liegeplätze damit ausgestattet seien. Allerdings sei derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Schiffen in der Lage, sich an die Hochspannungs-OPS anzuschließen.
Erheblicher Investitionsbedarf und technische Probleme
„Insgesamt gesehen erfordert die umfassende Einführung alternativer Kraftstoffe und Energiequellen im Seeverkehrssektor erhebliche Investitionen, sowohl in die Infrastruktur als auch in die Ausbildung“, heißt es in dem Bericht. Es sei „unklar, ob die Produktion alternativer Energiequellen den erwarteten Bedarf decken kann, der sich parallel zu den Dekarbonisierungsstrategien des Sektors ergeben wird“. Zum Beispiel reiche die prognostizierte Elektrolysekapazität, um bis 2030 Wasserstoffbrennstoffe für 13 bis 19 Prozent der weltweiten Flotte zu liefern, wenn ausreichend Strom aus erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt und die Kapazität wie angekündigt ausgeweitet werde. Gleichzeitig müsse die Produktion von grünem Ammoniak auf das Drei- bis Vierfache gesteigert werden, um die prognostizierte Nachfrage zu decken. Die Autoren weisen darauf hin, dass es beim Einsatz von Ammoniak als Schiffstreibstoff noch Sicherheitsprobleme gibt.
Einige alternativen Treibstoffe würden weiterhin einen Pilotkraftstoff für die Verbrennung erfordern, und andere auch in Zukunft für NOx-Emissionen sorgen. „Dennoch können diese Herausforderungen durch den angemessenen Einsatz von Technologien und Vorschriften sowohl in der EU als auch im Rahmen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO bewältigt werden“, heißt es in dem Bericht weiter. (fh/alb)